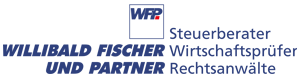Dezember
|
Private Trunkenheitsfahrt kann den Arbeitsplatz kosten |
|
Das Hessische Landesarbeitsgericht hat entschieden, dass ein Kraftfahrer, der bei einer privaten Autofahrt mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,36 Promille ertappt wird, seinen Arbeitsplatz verlieren kann. |
|
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.
|
|
Weihnachtsgeld - Auslegung einer arbeitsvertraglichen Vergütungsklausel |
|
In einem Fall aus der betrieblichen Praxis war in einem Arbeitsvertrag unter Punkt "Vergütung und sonstige Leistungen" u. a. Folgendes geregelt: "Die Zahlung von Gratifikationen, Tantiemen, Prämien und sonstigen Leistungen liegt im freien Ermessen des Arbeitgebers und begründet keinen Rechtsanspruch, auch wenn die Zahlung wiederholt ohne ausdrücklichen Vorbehalt der Freiwilligkeit erfolgte." In den Jahren 2006 bis 2008 zahlte der Arbeitgeber eine Sondervergütung, 2009 nicht. Der Arbeitnehmer verlangte jedoch die Zahlung aufgrund einer, nach seiner Auffassung, entstandenen betrieblichen Übung. |
|
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.
|
|
Auskunftsanspruch des "Scheinvaters" gegen die Mutter zur Vorbereitung eines Unterhaltsregresses |
|
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 9.11.2011 entschieden, dass dem "Scheinvater" nach erfolgreicher Vaterschaftsanfechtung und zur Vorbereitung eines Unterhaltsregresses ein Anspruch gegen die Mutter auf Auskunft über die Person zusteht, die ihr in der gesetzlichen Empfängniszeit beigewohnt hat. |
|
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.
|
|
Elterngeld - Bestimmung des günstigeren Berechnungszeitraums |
|
Elterngeld wird grundsätzlich nach dem Einkommen aus Erwerbstätigkeit berechnet, das in den 12 Kalendermonaten vor der Geburt des Kindes durchschnittlich erzielt worden ist. Bei der Bestimmung der für die Einkommensermittlung maßgebenden 12 Kalendermonate bleiben Monate unberücksichtigt, in denen die berechtigte Person Elterngeld für ein älteres Kind oder Mutterschaftsgeld bezogen hat oder in denen wegen einer auf die Schwangerschaft zurückzuführenden Erkrankung Erwerbseinkommen weggefallen ist. |
|
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.
|
|
Umfang des Insolvenzschutzes bei Pauschalreisen |
|
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall wurde Anfang 2009 über einen Reiseveranstalter eine Kreuzfahrt gebucht, die Anfang 2010 hätte stattfinden sollen. Nachdem der "Sicherungsschein für Pauschalreisen" ausgestellt wurde, überwiesen die Urlauber den Reisepreis von jeweils 7.400 € an den Reiseveranstalter. Anfang August 2009 teilte der Reiseveranstalter den Urlaubern mit, dass die Reise mangels Nachfrage nicht stattfinde. Bereits einen Monat später wurde durch das Insolvenzgericht die vorläufige Verwaltung des Vermögens des Reiseveranstalters angeordnet, Anfang Dezember 2009 das Insolvenzverfahren eröffnet. |
|
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.
|
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt.
Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.
Bitte beachten Sie, dass diese Steuernews eine individuelle Beratung nicht ersetzen können. Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieser Beiträge erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe der Steuernews berücksichtigt.